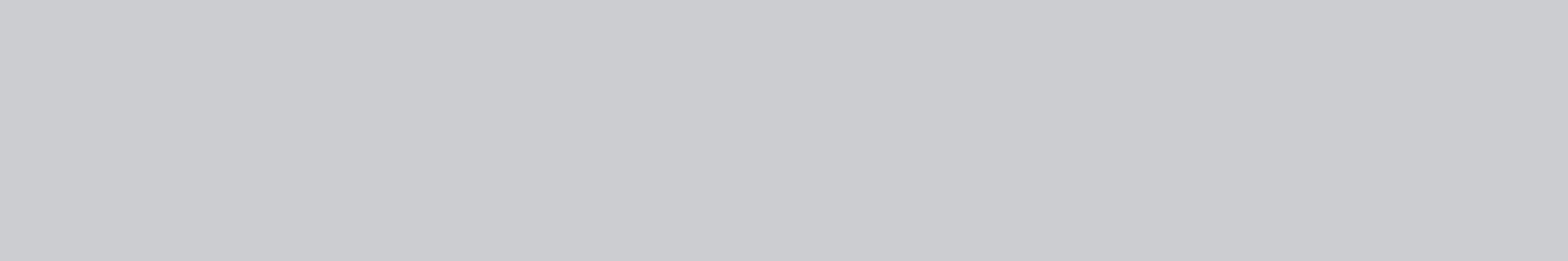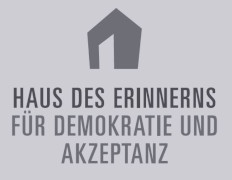geb. Rozalia Luksenburg
5. März 1871–15. Januar 1919
Staats- und Wirtschaftswissenschaftlerin, sozialistische Politikerin und Mitgründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
Rosa Luxemburg war zeitlebens eine einflussreiche Vertreterin des demokratisch-sozialistischen Denkens und Handelns. Geboren wurde sie am 5. März 1871 in Zamość in Kongresspolen im Kaiserreich Russland. Sie war das fünfte und letzte Kind der jüdischen Eltern Eliasz Luxenburg und Line, geborene Löwenstein. Ihre Eltern gehörten weder einer Religionsgemeinschaft noch einer politischen Partei an, sympathisierten allerdings mit der polnischen Nationalbewegung. Auch sprach die Familie zuhause sowohl Polnisch als auch Deutsch, aber kein Jiddisch. Nach der Übersiedlung der Familie nach Warschau, besuchte Rosa Luxemburg ab 1880 das Zweite Warschauer Mädchengymnasium, wo sie eine umfassende humanistische Bildung genoss. Schon in dieser Zeit engagierte sie sich in illegalen politischen Zirkeln. Als Klassenbeste bestand sie 1888 ihr Abitur. Aufgrund ihrer oppositionellen Haltung und Mitgliedschaft in der marxistischen Gruppe „Proletariat“ wurde sie jedoch durch die Zarenpolizei verfolgt, weswegen sie noch im selben Jahr in die Schweiz floh.
1890 begann sie ihr Studium an der Philosophischen Fakultät der Züricher Universität und besuchte hier insbesondere Seminare zur Staatswissenschaft, zur mittelalterlichen Geschichte sowie zur Geschichte der Wirtschafts- und Börsenkrise. Die junge Rosa Luxemburg war eine Verfechterin der Schriften von Karl Marx, mit denen sie sich auch im Zuge ihres Studiums immer wieder beschäftigte. 1893 unterbrach sie ihr Studium, um ihre politischen Aktivitäten voranzubringen und die polnische sozialdemokratische Zeitschrift „Sache der Arbeiter“ in Paris zu gründen. Ab 1891 hatte sie eine Liebesbeziehung mit dem polnischen Marxisten Leo Jogiches, mit dem sie auch am ersten – illegalen – Kongress der sozialdemokratischen Arbeiterpartei des Königreichs Polen in Warschau teilnahm. Zeitlebens waren die beiden politisch eng verbunden, so kämpften sie für eine internationale Bewegung gegen Kapitalismus und Monarchie. Jogiches finanzierte unter anderem Rosa Luxemburgs Studium, das sie 1897 mit einer Promotion zum Thema „Die industrielle Entwicklung Polens“ in Zürich abschloss.
Von 1898 bis 1903 ging Luxemburg eine Scheinehe mit dem deutschen Staatsbürger Gustav Lübeck ein, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. So wurde ihr die Mitarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung ermöglicht. Im Jahr der Eheschließung siedelte Rosa Luxemburg nach Berlin über und schloss sich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) an, wo sie schnell zur Wortführerin des linken Flügels der Partei wurde. Aufgrund kritischer Äußerungen in Bezug auf Kaiser Wilhelm II. wurde sie 1904 wegen „Majestätsbeleidigung“ zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, von denen sie sechs Wochen verbüßen musste. Ein Jahr später reiste sie gemeinsam mit Leo Jogiches nach Warschau, um dort die russische Revolution zu unterstützen. Hier wurde sie im März 1906 verhaftet und konnte nur durch eine hohe Kaution einem Kriegsgerichtsverfahren mit drohender Todesstrafe entgehen. Im selben Jahr wurde sie in Weimar wegen „Anreizung zum Klassenhass“ zu zwei Monaten Haft verurteilt, die sie voll verbüßte.
Schon früh warnte Luxemburg vor einem drohenden Krieg der europäischen Großmächte. So brachte sie 1907 beim Kongress der Zweiten Internationale in Stuttgart erfolgreich eine Resolution ein, die alle europäischen Arbeiterparteien zum gemeinsamen Handeln gegen den Krieg vereinte. Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erschien Luxemburgs Hauptwerk mit dem Titel „Die Akkumulation des Kapitals“. Darin folgte sie den Ideen Karl Marx‘ und sah im Imperialismus eine Gefahr für den Weltfrieden. Zudem rief sie durch öffentliche Reden zur Kriegsdienstverweigerung auf. Aufgrund dieses Aufrufs wurde sie am 20. Februar 1914 wegen „Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und gegen Anordnungen der Obrigkeit“ angeklagt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Ehe sie die Haftstrafe antrat, konnte sie noch an einer Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros teilnehmen, bei der sie ernüchtert feststellen musste, dass Nationalismus auch innerhalb der sozialistischen Parteien stärker war als internationale Solidarität. Doch auch innerhalb der Partei fand sie Anhänger ihrer Ideen. So formierte sich Anfang 1915 um sie und Karl Liebknecht ein linker Kern, der zunächst „Die Internationale“, später dann „Spartakusbund“ benannt wurde.
1915 wurde das Gerichtsurteil des Vorjahres vollstreckt und Luxemburg im Frauengefängnis in Berlin inhaftiert. Nur drei Monate später wurde sie nach dem damaligen Schutzhaftgesetz zur „Abwendung einer Gefahr für die Sicherheit des Reichs“ zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Während ihrer Haftzeit, die bis November 1918 dauerte, erfuhr sie von Lenins „Roter Oktoberrevolution“ in Russland, die sie zwar begrüßte, zugleich aber auch kritisierte: So war für sie eine Revolution erst dann umgesetzt, wenn die Macht vom Volk ausgehen konnte. Sie trat folglich auch gegenüber dem russischen Revolutionsführer für eine umfassende Meinungsfreiheit ein. Von Rosa Luxemburg stammt diesbezüglich der berühmte Satz: „Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“ (Rosa Luxemburg: Die russische Revolution. Eine kritische Würdigung, Berlin 1922).
Am 9. November 1918, dem Tag an dem Philipp Scheidemann eine deutsche Republik und Karl Liebknecht eine sozialistische Republik ausriefen, wurde Rosa Luxemburg aus der Haft entlassen. Schon am 10. November traf sie in Berlin ein, wo sie gemeinsam mit Karl Liebknecht die Zeitung des Spartakusbundes „Die Rote Fahne“ herausgab und maßgeblich an der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) beteiligt war. Luxemburg befürwortete eine Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung, wurde jedoch von der Mehrheit überstimmt.
Bei den Januarunruhen 1919, die zum Ziel hatten, die Wahl zur Nationalversammlung zu verhindern und die Errichtung einer Räterepublik zu erwirken, musste Rosa Luxemburg wegen Verhaftungsgefahr mehrmals ihre Wohnung wechseln. Sie weigerte sich jedoch, Berlin zu verlassen. Am 15. Januar wurde sie gemeinsam mit Karl Liebknecht verschleppt und im Eden-Hotel von Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division verhört und misshandelt. Als man sie vom Hotel abtransportieren wollte, wurde sie durch den Freikorps-Leutnant Hermann Souchon, ermordet. Auch Karl Liebknecht wurde an diesem Tag erschossen. Der Mord an Rosa Luxemburg sollte so aussehen, als sei sie während dem Abtransport von einer aufgebrachten Menschenmenge getötet worden. Ihren Leichnam warf man in den Berliner Landwehrkanal, wo er am 31. Mai 1919 gefunden wurde.
Der Todestag Rosa Luxemburgs wurde zu einem Gedenktag linker Bewegungen. Ihr Leben und Wirken wurden in zahlreichen Bildern und Werken rezipiert, so unter anderem in Arnold Zweigs „Grabrede für Spartakus“. 1990 gründete sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht.
Gerade aufgrund ihres Kampfes für eine internationale Arbeiterbewegung und gegen Krieg, gilt sie als eine Streiterin für Freiheit, Gleichheit und Frieden. Sie war zeitlebens eine engagierte Politikerin, die auch heute noch vor allem für ihre Kritik an Imperialismus und Kapitalismus sowie für ihren Kampf gegen Autoritäten und für die Meinungsfreiheit und Emanzipation des Menschen bekannt ist.
Novemberrevolution
Im Oktober 1918 herrschte im Deutschen Reich eine niedergeschlagene Stimmung. Der Erste Weltkrieg, der seit 1914 in Europa tobte und ca. neun Millionen Soldaten forderte, war so gut wie verloren. Daher fanden auch die ersten Gespräche zum Waffenstillstand statt. Trotzdem bekam die Marine noch einmal den Befehl, am 24. Oktober 1918 auszulaufen, um gegen die Royal Navy in ein letztes „ehrenvolles“ Gefecht zu ziehen.
Jedoch weigerten sich die kriegsmüden Matrosen diesen Befehl auszuführen und meuterten in Kiel und Wilhelmshaven. Rasend schnell breitete sich dieser Aufstand im Rest des Landes aus, da auch die Arbeiter nach Jahren von Hunger und Tod ein rasches Ende des Krieges herbeisehnten. Neben dem Ende des Krieges wurden aber auch Forderungen nach der Abdankung des Kaisers und einer demokratischen Umstrukturierung des Staates laut. In allen großen deutschen Städten formierten sich „Arbeiter- und Soldatenräte“, die die Verwaltung über die Städte übernahmen.
Auch in Mainz kamen am 8. November 1918 50 bewaffnete Matrosen an, die die Revolution in Mainz verbreiten wollten. Sie befreiten zunächst Insassen der Mainzer Gefängnisse und weitere in Mainz stationierte Soldaten schlossen sich ihnen an, woraufhin es in der Stadt zu Plünderungen kam. Am 9. November bildete sich ein „Arbeiter- und Soldatenrat“, der aus Vertretern der Sozialdemokraten, der Gewerkschaften und des Militärs bestand. Dieser kooperierte mit dem Oberbürgermeister, um kein Chaos herrschen zu lassen. Die Mainzer Räteherrschaft hielt jedoch nicht besonders lang, da schon am 9. Dezember französische Truppen als Sieger des Kriegs Mainz besetzten und bis zum Jahre 1930 in der Stadt blieben.
Am 9. November 1918 erreichte die Revolution schließlich auch Berlin. Mit Demonstrationszügen von Hunderttausenden zogen Arbeiter und Soldaten, die eigentlich der Monarchie nahestanden, durch die Berliner Straßen. So erwirkten sie, dass der Reichskanzler Prinz Max von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. gegen dessen Willen erklärte und mit seinem Rücktritt das Amt des Reichskanzlers an Friedrich Ebert, den Vorsitzenden der SPD, die zu diesem Zeitpunkt die größte Partei Deutschlands war, übergab.
Zudem kam es am 9. November zur doppelten Ausrufung der Republik, da Eberts Parteigenosse Philipp Scheidemann die deutsche Republik und zeitgleich der USPD-Politiker Karl Liebknecht die „freie sozialistische Republik Deutschlands“ proklamierten. Diese doppelte Ausrufung stand auch für die in sich gespaltene Revolutionsbewegung. Auch in Mainz kam es zu solch einer Proklamation. Dafür begab sich der Vorsitzende des Mainzer Arbeiter- und Soldatenrates, Bernhard Adelung, am 10. November vor die Stadthalle und rief die Republik aus.
Innerhalb des neuen politischen Spektrum taten sich direkt tiefe Gräben in der Politik auf. Auf rechter Seite standen die Anhänger der alten Ordnung, wie die der staatlichen Einrichtungen und der Armee. Zudem gab es die gemäßigten Kräfte der gemäßigten SPD, die gemeinsam mit dem Zentrum und den Linksliberalen für einen demokratischen Staat standen. Auf linker Seite gab es die Linksrevolutionären, die nach russischem Vorbild die Demokratie generell ablehnten und für eine sozialistische Räterepublik einstanden, unter ihnen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Sie waren es auch die den Spartakus, eine Vereinigung von Russlandnahen linksrevolutionären Kommunisten, denen der Kurs der SPD nicht radikal genug war, anführten. Aus diesem Bund ging letztlich auch die KPD hervor. Schließlich bildete sich am 10. November der Rat der Volksbeauftragten, der aus je drei Mitgliedern der SPD und der USPD bestand. An seiner Spitze standen Friedrich Ebert (SPD) und Hugo Haase (USPD). Dieser Regierung wurde die Loyalität des Militärs durch General Wilhelm Groener ausgesprochen, der im Gegenzug die Autonomie des Militärs sichern konnte. Mithilfe der Armee konnte Ebert schließlich auch seine Macht in den inzwischen bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen sichern.
Am 11. November 1918 fand schließlich auch der Erste Weltkrieg sein Ende, als Matthias Erzberger und Ferdinand Foch in Compiègne den Waffenstillstand unterschrieben. Dieser wurde in einer für Deutschland aussichtslosen Lage verhandelt und sorgte innenpolitisch für schockierte Reaktionen. Aus allen Lagern empfand man die Konditionen, zu denen der Waffenstillstand verhandelt worden war, als zu hart und stark erniedrigend.
Auf dem „Reichskongress der Arbeiter- und Sozialräte“ Mitte Dezember konnte Ebert schließlich auch eine parlamentarische Demokratie durchsetzen. Da die USPD und vor allem der Spartakusbund von dieser mehrheitlichen Entscheidung enttäuscht waren, brachen weitere Straßenkämpfe in Berlin aus. Mithilfe des Militärs konnten aber auch diese Aufstände niedergeschlagen werden; jedoch nicht ohne Blutvergießen. Mit dem Eingreifen der Armee war die USPD endgültig von der SPD enttäuscht und verließ den Rat der Volksbeauftragten am 28. Dezember. Auch zum Jahresbeginn 1919 gab es weitere Aufstände, die von der neu gegründeten KPD ausgingen. Zu diesen „Januaraufständen“ riefen auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf, die zuvor immer für friedliche Lösungen eingestanden waren.
Letztlich konnte die Regierung durch die Aufstände jedoch nicht gestürzt werden. So kam es am 19. Januar 1919 zu den ersten Wahlen in Deutschland, an denen auch Frauen ein Stimmrecht besaßen. Aus diesen Wahlen ging die sogenannte „Weimarer Koalition“ hervor, die durch eine Dreiviertelmehrheit aus SPD, Zentrum und DDP gebildet wurde. Auch in den ersten Monaten der jungen Republik blieben weitere Aufstände nicht aus. Gerade durch die Ermordung Liebknechts und Luxemburgs und durch die Kooperation der SPD mit dem Militär radikalisierten sich viele Arbeiter. So gab es bei den Märzkämpfen in Berlin erneut fast 1.200 Tote. Nichtsdestotrotz kam es nicht mehr zu derart großen Protesten wie im November und Dezember 1918.
Literaturhinweise:
Albrecht, Kai-Britt: Rosa Luxemburg 1871–1919, in: LeMo-Biografien, Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/biografie/rosa-luxemburg> [aufgerufen am 23.04.2020].
Dath, Dietmar: Rosa Luxemburg, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2010.
Gallus, Alexander (2018): Die deutsche Revolution, in : Bundeszentrale für politische Bildung Online, <URL: https://www.bpb.de/themen/erster-weltkrieg-weimar/weimarer-republik/275865/die-deutsche-revolution-1918-19/ > [aufgerufen am 22.03.2022].
Hebeisen, Michael (2013): Die Revolution die nicht stattfand, in: Roth, Jonathan (HG), Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz – Dokumente aus drei Jahrhunderten, <URL: https://www.sozialdemokratie-rlp.de/dokumente/die-revolution-die-nicht-stattfand.html > [aufgerufen am 22.03.2022].
Novemberrevolution 1918/19, in Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Online, <URL: https://www.lpb-bw.de/novemberrevolution#c61318 > [aufgerufen am 22.03.2022].
Piper, Ernst: Rosa Luxemburg. Ein Leben, Blessing, München 2018.
Scriba, Arnulf: Arbeiter- und Soldatenräte, in: Deutsches Historisches Museum Berlin/Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/revolution-191819/arbeiter-und-soldatenraete.html > [aufgerufen am 22.03.2022].
Scriba, Arnulf: Die Revolution von 1918/19, in: Deutsches Historisches Museum Berlin/Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/revolution-191819.html > [aufgerufen am 22.03.2022].