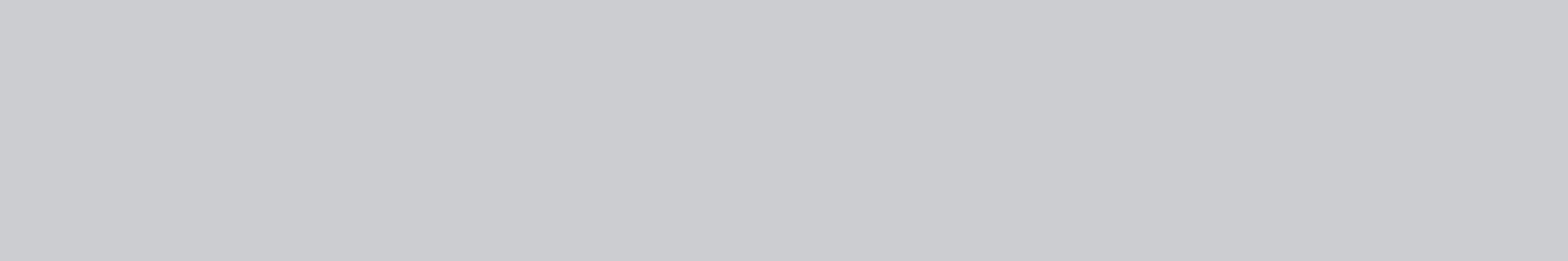Miriam Breß erforscht im Rahmen ihrer Promotion die Schutzhaftpraxis in der Pfalz zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur. Mit ihr sprachen wir über ihr Promotionsthema und die Vermittlung von Forschungsergebnissen über Social Media Kanäle wie Twitter.
Interview: Dr. Cornelia Dold & Janika Schiffel | Dezember 2020

Zur Person
Miriam Breß absolvierte ein Bachelor-Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden sowie der Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hier schloss sie anschließend das Masterstudium in Geschichte und Erziehungswissenschaften ab. Gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung promoviert Miriam Breß zur Schutzhaftpraxis 1933/34 in der Pfalz. Regelmäßig nutzt sie Twitter, um über das Forschungsthema zu informieren.
Sie promovieren momentan zur Schutzhaftpraxis 1933/34 in der Pfalz. Was genau verbirgt sich hinter Ihrem Forschungsschwerpunkt und wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Durch die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ (die sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“) vom 28. Februar 1933 wurden Grundrechte, wie das Recht auf persönliche Freiheit, außer Kraft gesetzt. Verhaftungen außerhalb der Strafhaft, Untersuchungshaft und der klassischen Polizeihaft waren dadurch möglich. Diese Haft, die aufgrund der Suspendierung des Grundrechts der persönlichen Freiheit im Kriegs- beziehungsweise Ausnahmezustand erfolgen konnte, wurde bereits seit dem Ersten Weltkrieg „Schutzhaft“ genannt. Das NS-Regime weitete die „Schutzhaft“ erheblich aus, verschärfte sie nachdrücklich und machte sie zu einem wesentlichen Herrschaftsinstrument. Reichsweit setzten seit Inkrafttreten der Verordnung Massenverhaftungen ein. Betroffen waren von diesen laut aktuellen Schätzungen allein im März und April 1933 etwa 40.000 bis 50.000 Männer und Frauen.
Ich untersuche die Praxis der „Schutzhaft“ in der Pfalz. Mein Untersuchungszeitraum erstreckt sich dabei von der Aufhebung des Grundrechts Ende Februar 1933 bis Mitte April 1934, als erstmals versucht wurde, die „Schutzhaft“ reichseinheitlich zu regeln. Zuvor war sie, als eine Art Polizeihaft, Ländersache. Für meine Forschung interessieren mich vor allem die Fragen: Wer wurde verhaftet? Welche Funktionen hatten die Verhaftungen? Wer war für die Verhaftungen zuständig? Wer führte sie aus? Die Pfalz ist dabei ein interessantes Untersuchungsgebiet, weil sie die ‚Provinz‘ darstellt. Hier sieht man, wie vor Ort – weit entfernt von Berlin und München – Verfolgungen ‚gestaltet‘ wurden.

Zum Thema selbst bin ich klassisch durch viele ‚Zufälle‘ gekommen. Im Erststudium hatte ich das Glück ein zweisemestriges Studienprojekt von Prof. Karlheinz Schneider, dem damaligen Vorsitzenden des Aktiven Museums Spiegelgasse in Wiesbaden, zu „Erinnerungskultur“ belegen zu können. Als ich 2009 über ein Thema für meine erste B.A.-Arbeit, die ich bei ihm verfasste, nachdachte, erfuhr ich von der Gründung des Fördervereins „Gedenkstätte für NS-Opfer e.V.“ in Neustadt an der Weinstraße. Infolge kam ich mit dem Vorsitzenden des Fördervereins, Eberhard Dittus, in Kontakt, verfasste meine B.A.-Arbeit zur „Erinnerungskultur in Neustadt“ und war längere Zeit im Verein aktiv. Als ich mit dem Geschichtsstudium anfing, widmete ich mich allerdings erst einmal anderen Themen, wie der „Judenzählung“ im Ersten Weltkrieg und der Verfolgung von Transidenten in den 1930er-Jahren in Hamburg. Letztlich waren es private Gründe, die 2016/2017 ausschlaggebend waren, ein pfälzisches Thema aus all den überlegten möglichen Masterarbeitsthemen zu wählen und damit zum (frühen) Konzentrationslager Neustadt, das ja auch schon bei meiner ersten B.A.-Arbeit eine Rolle spielte, zurückzukommen. Bei der Bearbeitung meiner Masterarbeit zum Lager fiel dabei immer wieder auf, dass ein großer Teil der Gefangenen vor ihrer Verbringung in das Lager oder im Zuge der Lagerauflösung in Gerichtsgefängnissen war. Auch fiel auf, dass bei ihrer Verfolgung viele Institutionen, Behörden und auch Privatpersonen mitwirkten. Ich wollte mich daher mit dem Instrument beschäftigen, das die Verhaftungen möglich machte – auch, um die Involvierung von unterschiedlichen Personen(-gruppen) in die Schutzhaftmaßnahmen näher zu beleuchten.
Welche Erkenntnisse haben Sie bisher über die Schutzhaftpraxis in der Pfalz in den ersten Jahren der NS-Diktatur gewonnen? Gibt es Merkmale, die spezifisch für diese Region sind?
Zu Beginn der Untersuchung ging ich – rückblickend sehr naiv – davon aus, dass in meinem Untersuchungszeitraum (Februar 1933 bis April 1934) circa 900 Männer und Frauen in der Pfalz in „Schutzhaft“ waren. Mittlerweile sind mir fast 2.600 Schutzhaftgefangene namentlich bekannt, wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden muss. Allein in den ersten Wochen nach der Machtübernahme 1933 wurden über 1.000 Männer und Frauen in der Pfalz in „Schutzhaft“ genommen.
Auffallend ist, dass es sich bei den Schutzhaftgefangenen nicht einmal im Ansatz primär um parteipolitische Gegner und Gegnerinnen aus der Arbeiterbewegung (KPD, SPD, SAP) handelt, auch wenn sie im März/April 1933 die größte Gruppe unter den Schutzhaftgefangenen stellten. Betroffen von Verhaftungen mittels der „Schutzhaft“ waren von Beginn an vor allem auch Jüdinnen und Juden. Zahlreiche Männer und Frauen kamen zudem in „Schutzhaft“, weil sie NS-Maßnahmen ‚sabotierten‘ oder sich negativ zum NS äußerten. Dies umfasste zum Beispiel Äußerungen gegen führende Nationalsozialisten, aber auch die Verweigerung eines erpressten Gehaltsverzichts. Weiterhin wurden viele Personen in „Schutzhaft“ genommen, die als „Separatisten” und „Franzosenfreunde” galten. Durchgängig – allerdings mit klarem Schwerpunkt im Juni 1933 – waren auch Männer und Frauen aus dem katholischen Milieu (unter anderem Zentrums/BVP-Politiker, Pfalzwachtmitglieder und katholische Geistliche) von Inschutzhaftnahmen betroffen. Letztlich richtete sich im März und im Juni die „Schutzhaft“ auch gegen den „Stahlhelm“, insbesondere aufgrund eines Streites zwischen diesem und der SA/SS um freigewordene Stellen. Stark vereinzelt befanden sich wegen interner Konflikte auch immer wieder SA/SS-Männer in „Schutzhaft“.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist die der breiten Zusammenarbeit bei den Inschutzhaftnahmen. Die Verhängung der „Schutzhaft“ lag in der Zuständigkeit der Bezirksämter beziehungsweise der Polizeidirektionen und Staatspolizeiämter, die durch sogenannte SA-Sonderkommissare ergänzt wurden. Diese setzten nicht nur die Anweisungen des Bayerischen Innenministeriums beziehungsweise der Bayerischen Politischen Polizei zu Inschutzhaftnahmen bestimmter Personengruppen um, sondern dehnten die Bestimmungen auch selbstständig aus eigenem Interesse aus. Ein besonderes Beispiel hierzu ist die Polizeidirektion Kaiserslautern, die beispielsweise „Holzfrevel“ mit „Schutzhaft“ ahndete. Letztlich fühlten sich viele Personen – Parteimitglieder und nicht Parteimitglieder – berufen, die „Schutzhaft“ zu nutzen. So wurde die Drohung mit „Schutzhaft“, dem (frühen) Konzentrationslager Neustadt und dem Konzentrationslager Dachau Alltag.

Generell sind Vergleiche mit anderen Regionen aufgrund der Forschungslage schwierig. Die Schutzhaftpraxis in Bayern 1933/1934 gilt ja als besonders ausufernd. Unklar ist meines Erachtens schon hier, ob dies tatsächlich so war oder einem internen Konflikt zu viel Wert beigemessen wurde. Dies müssten weitere Forschungen klären. Bezüglich Bayerns wird die Pfalz im März/April 1933 als der bayerische Regierungsbezirk genannt, in dem die „Schutzhaft“ am radikalsten angewandt und ausgeweitet wurde. Anfang 1934 hingegen galt die Pfalz als der Regierungsbezirk mit den wenigsten Inschutzhaftnahmen. Welchen Wert dies hat, ist eine andere Frage, denn „Schutzhaft“ wurde 1933/1934 immer ‚wellenförmig‘ angewandt. Sprich: Phasen von extremer Anwendung folgten immer wieder Phasen, in denen es kaum zu Inschutzhaftnahmen kam. Spezifisch für die Pfalz wird letztlich wohl vor allem sein, dass sich aufgrund der Grenzlage und der pfälzischen Geschichte viele Verfolgungen mit dem Vorwurf des „Separatismus“ nach außen legitimieren ließen.
Auch Antisemitismus war häufig eng mit der Schutzhaftpraxis in der Frühphase der NS-Diktatur verbunden. Was konnten Sie diesbezüglich bisher herausfinden?
Lange ging man ja davon aus, dass Jüdinnen und Juden in den ersten Jahren des NS-Regimes nur in die (frühen) Konzentrationslager verbracht worden waren, wenn sie parteipolitisch aktiv waren. Sie also als parteipolitische Gegnerinnen und Gegner und nicht aufgrund des Antisemitismus ihrer Verfolger und Verfolgerinnen in solche verschleppt wurden. Diese Darstellungen haben bereits einige neuere Studien, insbesondere die Studie von Kim Wünschmann „Before Auschwitz“, revidiert. In der Pfalz waren wohl circa 5% der Schutzhaftgefangenen jüdisch beziehungsweise galten ihren Verfolgern als jüdisch. Allein im frühen Konzentrationslager Neustadt, das im März/April 1933 – also in der ersten Hochphase des antisemitischen Boykotts – bestand, waren circa 12% der Schutzhaftgefangenen jüdisch. Auffallend ist insgesamt, dass es bei der antisemitischen Verfolgung starke regionale Unterschiede gab. Wo viele Menschen die NSDAP wählten, wurden bereits 1933 viele Jüdinnen und Juden verfolgt. Zahlreiche Personen hatten dabei ihr eigenes Interesse in die Verfolgungen fließen lassen. So nutzte beispielsweise ein Kaiserslauterer Rechtsanwalt die „Schutzhaft“ um gegen seine jüdischen Kollegen vorzugehen, ein Neustadter Ehepaar ging mit der „Schutzhaft“ gegen ihren jüdischen Vermieter vor und Landwirte sorgten für die „Schutzhaft“ von jüdischen Viehhändlern. Letztlich wurden jüdische Schutzhaftgefangene, vor allem im (frühen) Konzentrationslager Neustadt, aufgrund des Antisemitismus ihrer Verfolger schwer misshandelt. Einige jüdische Schutzhaftgefangene überlebten ihre Verfolgung 1933/1934 nicht. So starb der Neustadter Sigmund Farnbacher infolge seiner Misshandlung im (frühen) Konzentrationslager Neustadt im April 1933.
Warum haben Sie sich für einen regionalgeschichtlichen Schwerpunkt entschieden und worin sehen Sie dessen Gewinn?
Wie bereits geschildert, ist eine Themenfindung– wenn man durch ein Stipendium ohne vorgegebenen Themenschwerpunkt promovieren kann – vielen ‚Zufällen‘ geschuldet. Das ausschlaggebende für ein regionales Thema war für mich bei meiner Masterarbeit, zu der die Promotion dann führte, nüchtern gesagt schlicht der Quellenzugang, da ich parallel meine Großmutter pflegte und keine Archivreisen quer durch Deutschland oder darüber hinaus denkbar waren. Und das Landesarchiv Speyer ist ja zur Schutzhaftpraxis eine wahre Goldgrube.

Dass ich nach der Masterarbeit dann doch bei diesem Thema blieb und nicht wieder auf ein anderes ‚Wunschthema‘ umgeschwungen bin, liegt aber vor allem auch an den Potenzialen des Regionalen. Es ist oftmals noch das Bild verbreitet, dass die Provinz nur von Berlin aus gesteuert wurde. Parallel gibt es mittlerweile zahlreiche Forschungen, die zeigen, dass in der Provinz viele antisemitische Maßnahmen beispielsweise vorangetrieben wurden. Die Frage, wie es passieren konnte, dass aus einer Demokratie eine Diktatur wurde, lässt sich nicht beantworten, wenn man nicht auch das zahlreiche Mitwirken in der Provinz betrachtet. Der Nationalsozialismus wurde der deutschen Gesellschaft 1933 nicht ‚übergestülpt‘. Der Nationalsozialismus war Teil der Gesellschaft – auch der pfälzischen Gesellschaft. Und gerade in der Pfalz sieht man auch, wie die Gesellschaft vor Ort die sogenannte „Volksgemeinschaft“ durch In- und Exklusionen aktiv herstellte.
Auf Twitter sind Sie besonders aktiv und informieren Ihre Follower regelmäßig über Ihre Forschung. Warum haben Sie sich gerade für diesen Informationsweg entschieden?
Vornweg: Ich bin keine Expertin für Social Media. Anfang 2018 hatte ich mir einen Twitter-Account erstellt, um die Debatten zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz auch dort verfolgen zu können. Den Account nutzte ich aber lange nur passiv. Dass ich ihn seit circa April 2020 aktiv nutze, war schlicht der Corona-Pandemie geschuldet. Generell befinde ich mich momentan im letzten Jahr meiner Promotion, von der Finanzierung aus gesehen. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr mein Thema auf Veranstaltungen, Seminaren und Workshops vorstellen und zur Diskussion stellen. Dies war durch die Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Auch fielen Archiv- und Bibliotheksbesuche mit anderen Doktorandinnen und Doktoranden fast vollständig weg. Somit war auch kaum mehr ein Face-to-Face Austausch möglich beziehungsweise stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund habe ich angefangen meinen Twitter-Account auch aktiv zu nutzen.
Häufig ist Social Media als ‚Filterblase‘ oder ‚informationsleerer Raum‘ verschrien. Welche Vorteile kann eine Präsenz und Wissensvermittlung über Social Media Ihrer Meinung nach aber haben?
Wie gesagt, ich bin keine Expertin für Social Media und kann daher die Frage auch nur als twitternde Laiin beantworten. Grundsätzlich war ich überrascht, wie viele Personen mir auf einmal folgten. Diese Personen haben – soweit ich das sehe – unterschiedliche Hintergründe: Es sind einige Historikerinnen und Historiker, einige Pfälzerinnen und Pfälzer sowie Frauen und Männer, die sich politisch und gesellschaftlich engagieren, wobei es hierbei natürlich zahlreiche Schnittmengen gibt. Daraus sind einerseits einige Kontakte zu anderen Doktorandinnen und Doktoranden entstanden. Andererseits aber auch – womit ich über Twitter zunächst gar nicht gerechnet habe – zu Enkel- und Urenkelkindern von Männern und Frauen, die 1933/1934 verfolgt worden sind.
Welche weiteren Projekte planen Sie derzeit?
Ich habe während der Promotion immer mal wieder Vorträge gehalten und diverse Aufsätze verfasst. Insbesondere hat mich das Projekt „Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt – Neustadt a. d. Weinstraße und der Nationalsozialismus“, das unter Leitung meines Doktorvaters PD Dr. Markus Raasch entstand, meine gesamte bisherige Promotionszeit begleitet. Dieses vielfältige Projekt – neben einem Handbuch umfasst es eine Ausstellung, ein Zeitzeug*innen-Archiv, ein digitales Schulbuch und ein Online-Lexikon – wurde just in diesen Tagen öffentlich präsentiert.
Nun bin ich erstmals in der Situation, dass ich keine „Nebenprojekte“ habe und mich ausschließlich auf meine Dissertation konzentrieren kann. Das ist einerseits ein seltsames Gefühl, weil Projektarbeit und der damit verbundene Austausch mit Anderen sehr bereichernd ist, andererseits neigt sich die Finanzierung meiner Promotion mittlerweile dem Ende zu, sodass ich mich neuen (größeren) Projekten erst wieder nach Abschluss der Dissertation widmen möchte.